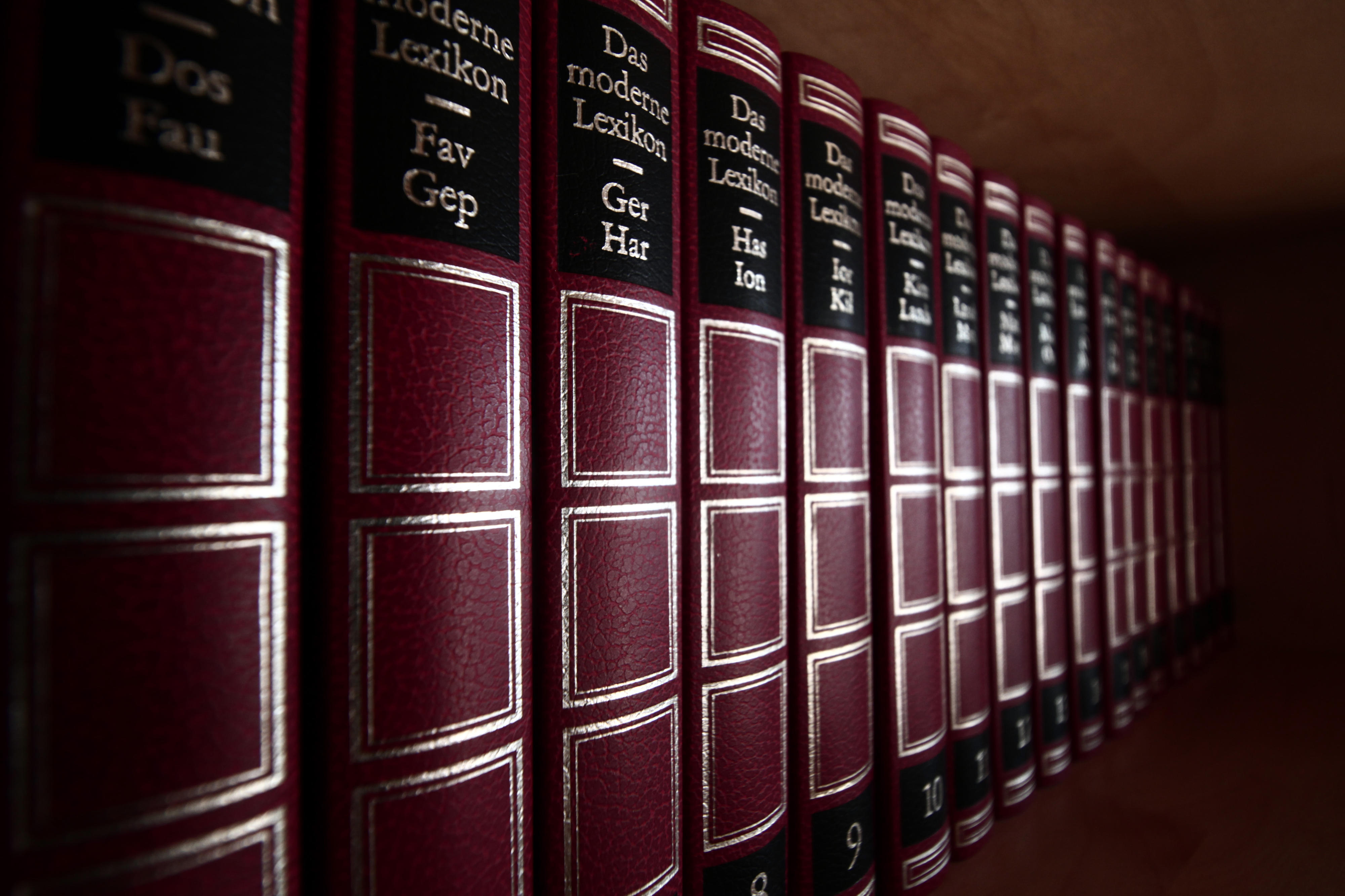Politische Situation Schleppende Reformschritte, innere Spannungen
Wähler in Togo bei den Parlamentswahlen 2013
Die Politik des seit 2005 amtierenden Präsidenten Faure Gnassingbé ist grundsätzlich entwicklungsorientiert: Die Regierung bemüht sich, soziale Schlüsselbereiche wie Bildung, Gesundheit und Infrastruktur zu stärken und die Geschäftsbedingungen für die private Wirtschaft zu verbessern. Das aktuelle Regierungsprogramm („Feuille de route 2025 (Externer Link)“) ist ausdrücklich auf die Ziele der Agenda 2030 (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) der Vereinten Nationen und die Agenda 2063 (Externer Link) der Afrikanischen Union ausgerichtet.
Im Jahr 2019 wurden 117 togoische Kommunen neu geschaffen beziehungsweise neu definiert und Kommunalwahlen durchgeführt. 2024 fanden Wahlen für die neu geschaffenen fünf Regionen statt. Mit der damit verbundenen Dezentralisierung und Dekonzentration von Macht und Entscheidungsbefugnissen sollen demokratische Strukturen gestärkt sowie eine größere politische und soziale Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht werden.
Demokratische Grundrechte wie Versammlungsfreiheit und das Demonstrationsrecht wurden in den vergangenen Jahren tendenziell eingeschränkt – zunächst im Zuge der Covid-19-Pandemie, später unter Berufung auf den erst nur im Norden verhängten und dann auf das ganze Land ausgeweiteten Ausnahmezustand aufgrund der terroristischen Bedrohung aus dem Sahel.
In Westafrika wirkt Togo grundsätzlich stabilisierend, die Regierung engagiert sich für eine enge regionale Zusammenarbeit. Bei Konflikten in der Region hat das Land wiederholt eine Vermittlerrolle eingenommen. Togo selbst ist zunehmend von einem Übergreifen terroristischer Gewalt aus der Sahel-Region betroffen: Seit 2021 wurden im Grenzgebiet zum nördlichen Nachbarland Burkina Faso wiederholt terroristische Anschläge registriert, die auch zivile Todesopfer forderten.
Wahlerfolge der Regierungspartei
Viele oppositionelle Kräfte zweifeln die Legitimität der Regierung an. 2017 und 2018 kam es landesweit zu Protesten. Hauptforderung war, die Macht des Präsidenten einzuschränken und eine vierte Amtszeit von Faure Gnassingbé zu verhindern. Unter Vermittlung der Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten (ECOWAS (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen)) wurde ein Fahrplan zur Überwindung der Krise erarbeitet. Dieser Vereinbarung folgend fanden im Dezember 2018 Parlamentswahlen statt, die jedoch von einem Großteil der Opposition boykottiert wurden.
Bei den Präsidentschaftswahlen 2020 erhielt Faure Gnassingbé bereits im ersten Wahlgang 71 Prozent der Stimmen.
Die Parlamentswahlen im April 2024 gewann seine Partei (Union pour la République, UNIR) überaus deutlich: In der Nationalversammlung stellt sie künftig 108 von 113 Abgeordneten. Und auch aus den erstmals abgehaltenen Regionalwahlen ging die UNIR als deutlicher Sieger hervor (137 von 179 Sitzen). Wahlbeobachter der Afrikanischen Union und der ECOWAS zeigten sich zufrieden mit dem Wahlablauf. Unabhängige Wahlbeobachter der katholischen Kirche wurden jedoch von der staatlichen Wahlkommission Togos nicht zugelassen. Die Akkreditierung ausländischer Journalisten wurde nach einem Zwischenfall mit einem kritischen französischen Journalisten und seiner Ausweisung aus Togo im Vorfeld der Wahlen vorübergehend ausgesetzt.
Umstrittene Verfassungsänderung
Im Vorfeld der – mehrfach verschobenen – Parlamentswahlen 2024 war es zu Protesten gekommen. Anlass war eine umstrittene Verfassungsänderung, die im März 2024 vom Parlament beschlossen worden war. Sie sieht den Übergang vom Präsidialsystem zu einer parlamentarischen Demokratie vor. Der Staatspräsident soll demnach künftig nicht mehr direkt vom Volk, sondern für eine einmalige Amtszeit von sechs Jahren vom Parlament gewählt werden. Viele Machtbefugnisse sollen vom Staatspräsidenten auf den Vorsitzenden des Ministerrats übergehen. Dieses neu geschaffene Amt des Regierungschefs soll nach einer Verlautbarung des togoischen Parlaments der Vorsitzende jener Partei oder Koalition übernehmen, die im Parlament die Mehrheit stellt.
Die Opposition und Teile der Zivilgesellschaft (Lexikon-Eintrag zum Begriff aufrufen) sehen in der Verfassungsänderung den Versuch von Präsident Gnassingbé, seine Macht zu erhalten, da er nach Ende seiner Amtszeit den Posten des Ministerratsvorsitzenden übernehmen könnte. Kritisiert wird auch, dass die Änderungen ohne jegliche öffentliche Debatte verabschiedet und nicht – wie in der Verfassung zwingend vorgesehen – per Referendum vom Volk bestätigt wurden. Mehrere Parteien und zivilgesellschaftliche Gruppen haben den Gerichtshof der ECOWAS angerufen, um die Verfassungsänderung prüfen zu lassen.
Historischer Hintergrund
Die Region am Golf von Guinea ist bereits seit Jahrhunderten besiedelt. Der heutige Staat Togo entstand jedoch erst Ende des 19. Jahrhunderts. Damals sicherte sich das Deutsche Reich das Gebiet als Kolonie; die Grenzen wurden von den verschiedenen in der Region anwesenden Kolonialmächten festgelegt. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Togo geteilt und unter britische und französische Verwaltung gestellt. Der britische Westteil Togos wurde 1957 Ghana angegliedert. Der französisch verwaltete Ostteil erhielt dagegen eine Teilautonomie und wurde 1960 als Republik Togo unabhängig. Die Bevölkerung Togos setzt sich aus mehr als 40 verschiedenen Ethnien zusammen.
1967 brachte ein Militärputsch Gnassingbé Eyadéma an die Macht. Er regierte das westafrikanische Land fast 40 Jahre lang zunehmend diktatorisch. Aufgrund massiver Menschenrechtsverletzungen stellte die internationale Gebergemeinschaft ihre Unterstützung für Togo 1993 ein. Die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen dieser Diktatur und der internationalen Isolierung sind bis heute spürbar.
Nach dem Tod Eyadémas 2005 setzte die Armee dessen Sohn Faure Gnassingbé als neues Staatsoberhaupt ein. Auf internationalen Druck hin fanden im selben Jahr äußerst umstrittene Präsidentschaftswahlen statt, die Gnassingbé gewann. 2010, 2015 und 2020 wurde er in international anerkannten Wahlen im Amt bestätigt.
Stand: 25.03.2025