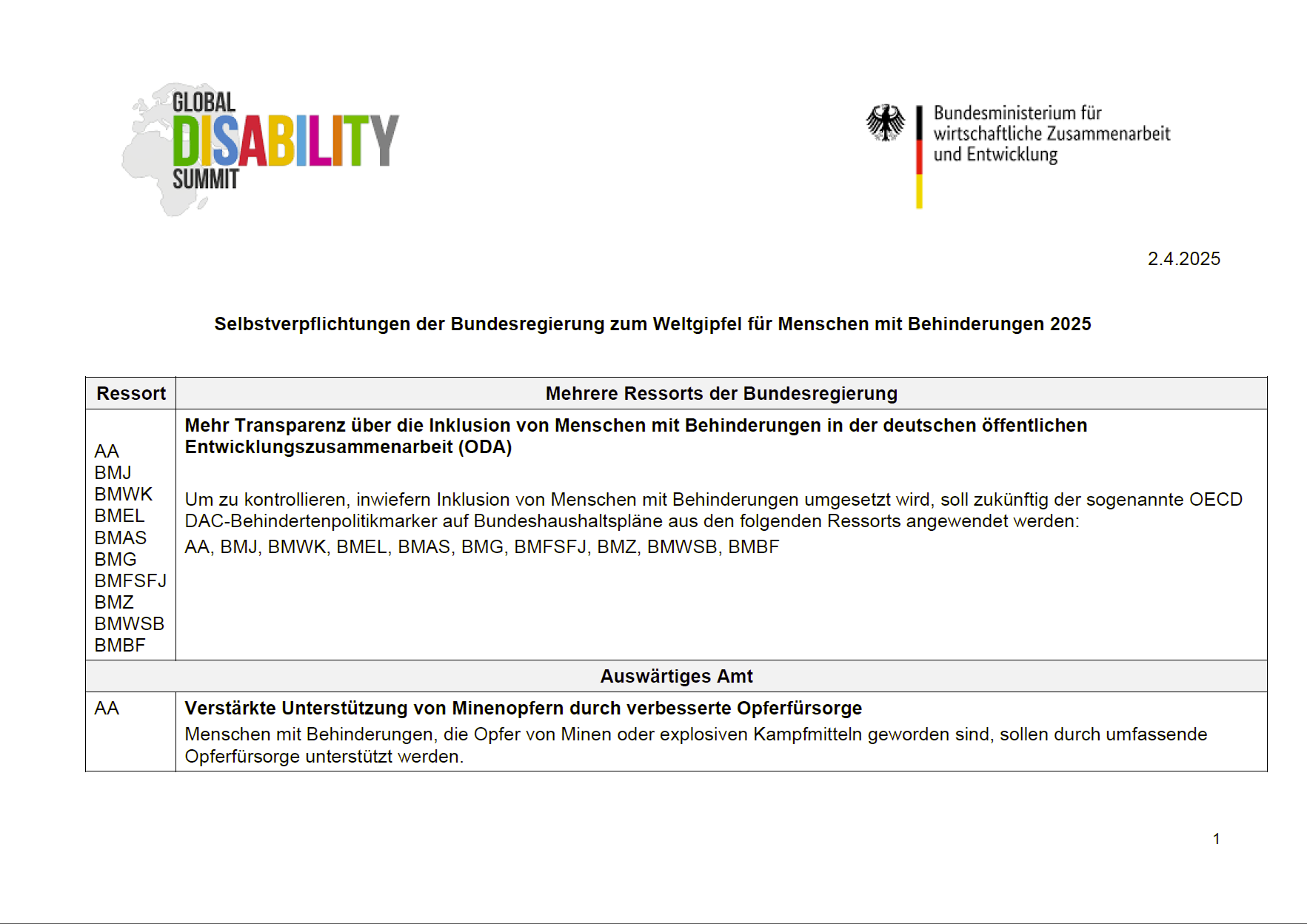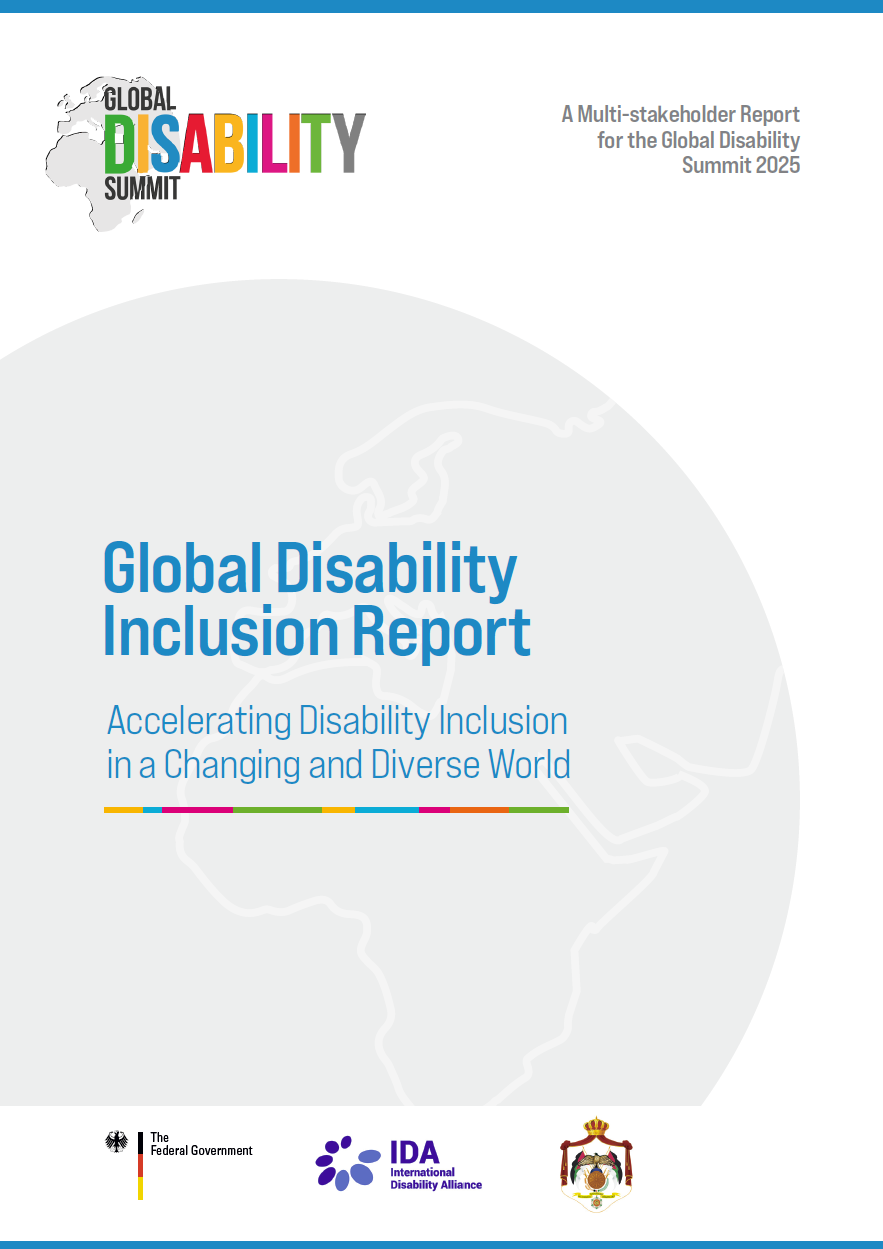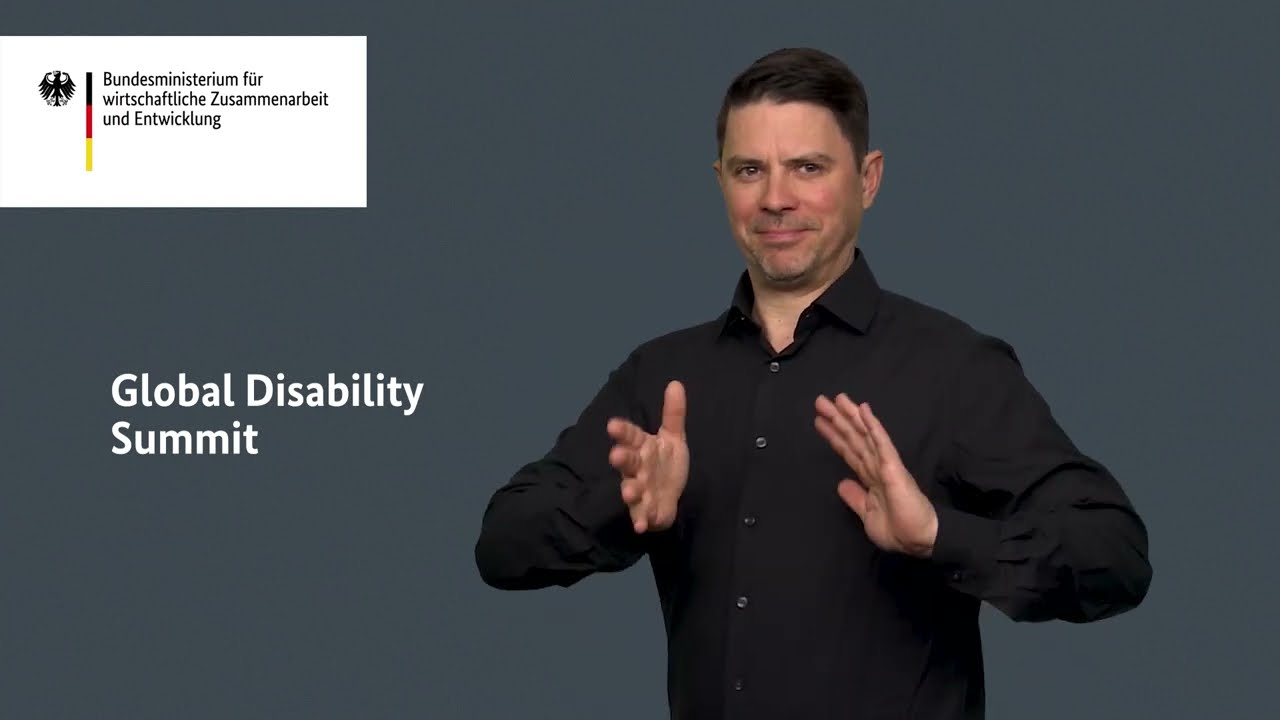Global Disability Summit (GDS) Weltgipfel für Menschen mit Behinderung soll Barrierefreiheit und Inklusion weltweit voranbringen
Entwicklungsministerin Svenja Schulze: „1,3 Milliarden Menschen weltweit leben mit Behinderungen. Viele von ihnen sind täglich mit Barrieren und Nachteilen konfrontiert. Wir alle müssen und können hier besser werden – auf der ganzen Welt. Die gute Nachricht ist: Es gibt bereits viele Erfahrungen und Ideen für mehr Inklusion und Barrierefreiheit, von denen wir und andere lernen können. Sie sind aber oft noch nicht bekannt genug. Dieser Gipfel kann dabei helfen, gute Ideen zu verbreiten und so die Welt Schritt für Schritt inklusiver zu machen für Menschen mit Behinderungen. Denn: Inklusion ist nicht nur ein wünschenswertes Ideal, sondern ein grundlegendes Menschenrecht.“
Menschen mit Behinderungen machen rund 15 Prozent der Weltbevölkerung aus. Fehlende Inklusion dieser Menschen bedeutet auch, dass Gesellschaften etwas verloren geht – Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zufolge bis zu sieben Prozent des Bruttoinlandsprodukts eines Landes.
Alle am Weltgipfel teilnehmenden Regierungen und Organisationen sind aufgerufen, konkrete Zusagen einzubringen. Diese können von kleinen Einzelmaßnahmen bis hin zu größeren Systemveränderungen reichen.
Deutschland bringt solche Selbstverpflichtungen ein: So setzt sich das Bundesfamilienministerium dafür ein, gemeinsam mit Verbänden die Prävention und den Schutz vor Gewalt auch in der häuslichen Pflege zu verbessern. Das Bundesverkehrsministerium fördert die Entwicklung einer App, um den öffentlichen Nahverkehr für Menschen mit Behinderung zu erleichtern. Jeder und jede kann dort selbst Daten zur Barrierefreiheit in Bahnen und Bussen, an Bahnhöfen und Haltestellen melden und so zu einem Informationssystem für barrierefreies Reisen beitragen.
Auch das Entwicklungsministerium legt heute konkrete Beiträge vor, die den Stellenwert von Inklusion in der internationalen Zusammenarbeit erhöhen sollen. Mit einer sogenannten Schuldenumwandlung ermöglicht die Bundesregierung der jordanischen Regierung, fünf Millionen Euro Schulden nicht an Deutschland zurückzuzahlen, sondern diese gezielt in inklusive Bildung von Kindern mit Behinderungen zu investieren.
Außerdem unterstützt das BMZ den Aufbau eines inklusiven „City Hubs“ – das ist ein Zusammenschluss von Stadtplanern, Sozialverbänden, Entwicklungsbanken und anderen, der Städte für Menschen mit Behinderungen barrierefreier machen soll. Bis Ende 2026 sollen Pilotprojekte in sechs ausgewählten Städten weltweit umgesetzt werden. Auf den Philippinen zum Beispiel geht es um Frühwarnsysteme im Katastrophenfall. Gearbeitet wird dort daran, wie die Warnungen bei allen Menschen ankommen und wie gut Evakuierungen vorbereitet werden – auch für Menschen, die Sirenensignale nicht hören, Warnschilder nicht sehen oder auf den Rollstuhl angewiesen sind.
Zum Ende des Gipfels morgen soll die sogenannte Amman-Berlin-Erklärung verabschiedet werden. Damit verpflichten sich die Staaten und Organisationen dazu, dass mindestens 15 Prozent ihrer entwicklungspolitischen Projekte die Inklusion der weltweit mehr als 15 Prozent Menschen mit Behinderungen fördern sollen.
Zudem wird morgen der vom Entwicklungsministerium in Auftrag gegebene „Global Disability Inclusion Report“ vorgestellt. Die von UNICEF koordinierte Studie hat zum Ziel, die Datenlage zur Situation von Menschen mit Behinderung zu verbessern – eine Forderung, die Verbände und Interessensvertretungen immer wieder stellen.
Der Studie zufolge haben Menschen mit Behinderung eine im weltweiten Durchschnitt um 14 Jahre geringere Lebenserwartung als Menschen ohne Behinderung. In den ärmsten Ländern beträgt die Lücke 23 Jahre, in den reichsten Ländern zehn Jahre.
Auch beim Zugang zu Therapien und Hilfsmitteln bestehen erhebliche Unterschiede: Während in den reichsten Ländern 88 Prozent der Menschen mit Behinderung Hilfsmittel wie etwa Prothesen, Rollstühle oder Hörgeräte nutzen können, sind es in den ärmsten Ländern nur elf Prozent.
Und während in den reichsten Ländern auf eine Million Einwohner mehr als 900 Physiotherapeuten kommen, sind es in ärmeren Ländern weniger als 30. Ebenso stehen in Ländern wie den USA und Australien mehr als 300 Sprachtherapeutinnen und Logopäden pro einer Million Einwohner zur Verfügung, in manchen Ländern Afrikas keine einzige.